Rhetorische Figuren sind Systeme der Sprache, welche Wörter und Sätze in einer ganz bestimmten Art und Weise nutzen, um beim Leser oder Hörer eine besondere Wirkung zu erzielen. Es kann auch eine Technik sein, um ein spezielles Gefühl zu erzeugen. Dies macht sich meist die Werbung zunutze.
Woher kommen rhetorische Figuren?
Die geläufigsten Stilmittel stammen vor allem aus der antiken Rhetorik und Poetik, daher kommen auch die Bezeichnungen meist aus dem Griechischen und Lateinischen, in wenigen Ausnahmefällen aus dem Französischen oder anderen Sprachen. Des Weiteren sind die Definitionen der Figuren unterschiedlich und einige Bezeichnungen werden als synonym betrachtet (z.B. Tautologie und Pleonasmus). In anderen Fällen bezeichnet ein Name in verschiedenen Systemen unterschiedliche Mittel (z.B. Katachrese).
Wo werden rhetorische Figuren eingesetzt?
Rhetorische Stilmittel werden oft in Werbung, Reden oder Schriftstücken eingesetzt und sollen eine besondere Wirkung auf den Leser erzielen. Einige Stilmittel werden jedoch alltäglich benutzt, beispielsweise die Ellipse.
Cicero setzte sich rege für den Gebrauch rhetorischer Figuren ein, um so den Geist des Hörers herauszufordern. John Locke stellte sich mit der Forderung nach einem wissenschaftlichen Stil gegen jegliche Figuration, die lediglich zur Verschleierung der Sinne führe.
Eine Übersicht der wichtigsten rhetorischen Figuren
|
Rhetorische Figur |
Erklärung |
Beispiel |
|---|---|---|
|
Akkumulation |
Eine Aneinanderreihung von Wörtern zu einem Oberbegriff, der genannt oder nicht genannt wird. |
Nun ruhen alle Wälder, Tiere, Menschen, Städte und Felder. |
|
Allegorie |
Konkrete Darstellung von abstrakten Begriffen oder Gedanken, oft durch Personifikation. |
Der Sensenmann als Skelett in schwarzer Kutte mit Sense in der Hand steht für den Tod. |
|
Anapher |
Wiederholung von Wörtern oder Wortgruppen bei Anfängen von Versen oder Sätzen zur Verstärkung des Gesagten. |
Ja, da kann man sich doch nur hinlegen. |
|
Apostrophe |
Scheinbare Abwendung des Sprechers vom Publikum und Anrede einer imaginären Person. Zum Beispiel wendet sich Antigone ab und richtet sich an die Götter. |
„Bedecke deinen Himmel, Zeus, / Mit Wolkendunst!“ *Johann Wolfgang von Goethe - Prometheus*
|
|
Alliteration |
Die Anfangslaute werden in benachbarten Wörtern wiederholt. |
Blaukraut bleibt Blaukraut, und Brautkleid bleibt Brautkleid. |
|
Antithese |
Gedanken und Begriffe werden gegenübergestellt. |
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. *Friedrich Schiller – Die Glocke* |
|
Chiasmus |
Kreuzstellung von syntaktisch oder semantisch einander entsprechenden Satzgliedern. |
Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. *Johann Wolfgang von Goethe – Faust* |
|
Correctio |
Ein zu schwacher Ausdruck wird korrigiert. |
Doch beachtet die Dummheit dieses Menschen, oder (ich sollte sagen =) besser gesagt: dieses Schafskopfs! *Cicero: Phlippicae 2:30* |
|
Ellipse |
Ein Satzteil, der nicht für das Verständnis wichtig ist, wird ausgelassen. |
1. Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde. *Johann Wolfang von Goethe* 2. Ende gut, alles gut. 3. Je früher, desto besser. 4. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. |
|
Epipher |
Wiederholung wichtiger Wörter oder Wortgruppen am Satz- oder Versende. Gegenstück ist die Anapher. |
Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit! *Friedrich Nietzsche* |
|
Euphemismus |
Beschönigende Umschreibung oder Verschleierung einer unschönen Tatsache oder unheilbringenden Sache. |
|
|
Hyperbel |
Eine starke Übertreibung, wobei der Begriff vergrößert oder verkleinert wird. |
|
|
Katachrese |
Hierbei handelt es sich um metaphorische Bilder, die nicht zusammenpassen. |
|
|
Klimax |
Eine dreistufige Steigerung eines Begriffs vom wenig Bedeutsamen zum Bedeutsamen oder vom Kleinsten zum Größten. |
|
|
Litotes |
Eine Bejahung mithilfe einer doppelten Verneinung oder untertriebene Ausdrucksweise. |
|
|
Metapher |
Übertragene Bedeutung oder sprachliche Verbindung zweier semantischer Bereiche, die nicht verbunden wären. |
|
|
Metonymie |
Ersetzung eines Worts durch ein anderes, welches zu diesem in einer unmittelbaren Relation steht. |
|
|
Onomatopoesie |
Lautmalerei, die so ähnlich klingt, wobei die akustischen Eindrücke durch die Sprache rekonstruiert werden. |
|
|
Oxymoron |
Zwei Wörter werden verbunden, die sich gegenseitig ausschließen. Erzielt eine pointierte Wirkung. |
|
|
Paradoxon |
Ein scheinbarer Widerspruch, da die Aussage zunächst unsinnig erscheint. Bei genauer Überlegung birgt sie jedoch eine Wahrheit. |
|
|
Parenthese |
Satzeinschub, der grammatisch selbständig ist und die Syntax nicht verändert. |
|
|
Periphrase |
Begriffsumschreibung durch andere Wörter. |
|
|
Personifikation |
Vermenschlichung abstrakter Begriffe oder lebloser Gegenstände, indem man ihnen menschliche Eigenschaften zuweist. |
|
|
Pleonasmus |
Doppeltes Begriffspaar; ein Wort, das durch einen charakteristischen Begriff beschrieben wird. |
|
|
Rhetorische Frage |
Scheinfrage, die keiner Antwort bedarf, um dem Gesagten Nachdruck zu verleihen. |
|
|
Symbol |
Sinnbild, das auf etwas Allgemeines hinweist. Meist ein Objekt, das für einen Sinnzusammenhang steht. |
|
|
Tautologie |
Begriffswiederholung oder Verbindung von zwei Begriffen, welche die gleiche Bedeutung haben. |
|




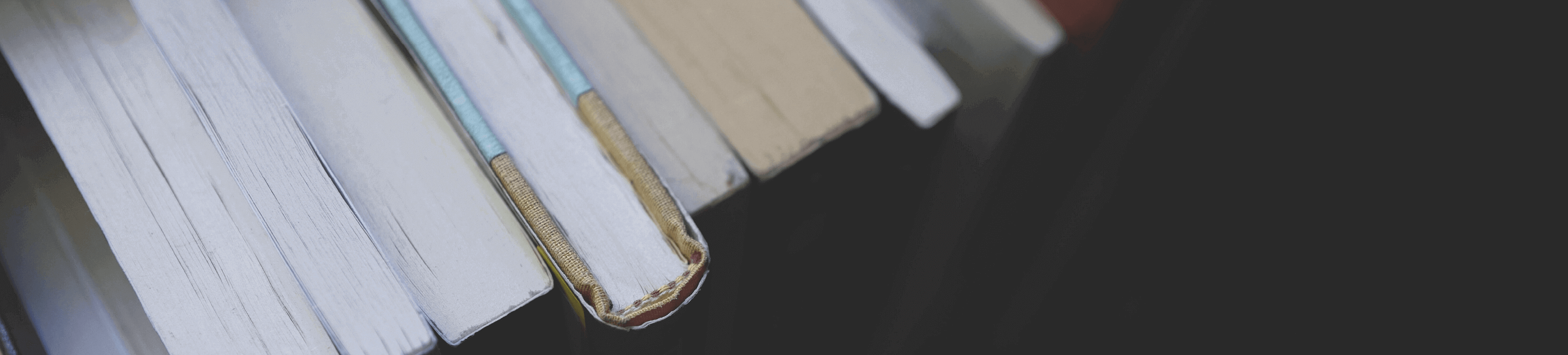








Neuen Kommentar hinzufügen